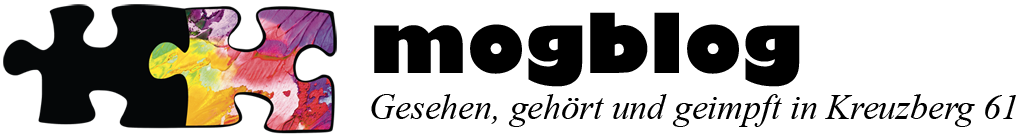Klaus Stark vermisst ein Miteinander in der Corona-Pandemie

Der wolkenlose, blaue Himmel, die Sonne und der kalte Ostwind werden in Erinnerung bleiben. Menschen in Supermärkten, die seltsame Tänze aufführen. Als wäre überraschend die Choreographie geändert worden und sie fänden sich noch nicht ganz zurecht. Wenn sie dann einen falschen Schritt machen, lächeln sie unsicher und ein bisschen entschuldigend.
Manche sagen, die Leute rücken in der Krise näher zusammen. Mir scheint der Kiez genau so bruchstückhaft wie zuvor. »Liebe Bedürftige«, schreiben da manche an Leute, die sie nicht kennen und denen sie niemals die Hand drücken würden, und hängen Lebensmittel an einen Gabenzaun, über die sich am Ende vermutlich die Ratten freuen. In einer Edelboutique werden schon wieder Kleiderständer auf die Straße gestellt – und ja, wenn man genau hinsieht, kann man in den Augen die Euro-Zeichen blinken sehen.
Krankenschwestern rackern für einen Hungerlohn, ein Rentnerpaar mit Mundschutz schlurft verängstigt und seltsam zukunftslos übers Trottoir. Gegenüber beim Späti klumpen Männer mit braunen Gesichtern und schwarzen Bärten zusammen. Breite Ellbogen, große Gesten. Kontaktverbot? Abstand zueinander? Nie gehört. Mir doch egal!
Ein großes Ganzes oder auch nur ein Gemeinsames ist nirgends in Sicht. Stattdessen treten im grellen Licht der Gefahr die Unterschiede nur umso plastischer hervor: Der Mundschutz verbirgt nicht, er macht sichtbar. Früher war das schwieriger. Jetzt braucht man nur kurz hinzusehen, um zu erkennen, ob einer sozial kompatibel ist oder nicht.
Ohnehin verläuft es sich. Die menschenleeren Straßen, die geschlossenen Spielplätze gaben der Pandemie ein Stück weit ein Gesicht. Jetzt tobt auf der Zossener wieder der übliche Stau, alle atmen auf und gehen den gewohnten, lieb gewordenen Fetischen nach. Die Katastrophe hat sich in häusliche Quarantäne zurückgezogen, in die Krankenhäuser und Altenheime. Dort wartet sie.