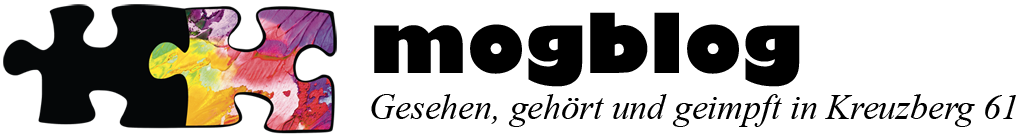Ein ganzes Haus bedankt sich bei der Berliner Feuerwehr

Vor ein paar Tagen hat es in meinem Haus gebrannt. Ein Bewohner war abends gegen halb neun vom Einkaufen zurückgekommen, stieg oben aus dem Aufzug, schnüffelte misstrauisch. Erst wenige Tage vorher hatte es im ganzen Treppenhaus nach Benzin gestunken, weil irgendwo ein Kanister ausgelaufen war. Roch das nicht schon wieder so? Gegen Rauch war der alte Mann ohnehin allergisch, er mochte das Nikotin in seinen Klamotten nicht, wenn er morgens in aller Früh aus der Eckkneipe nach Hause schlich. Und jetzt? War das nicht Rauch?
Erst mussten natürlich noch Kalbsleberwurst, Käse und Apfelsaft im Kühlschrank verstaut werden, aber dann guckte er nach. Ein paar Treppen tiefer: Rauch! Tatsächlich! Er stank und hing wie ein weißer Nebel im Treppenhaus. Irgendwo piepste hysterisch ein Brandmelder vor sich hin, wahllos drückte er auf ein paar Klingeln, schlug laut Alarm, da war die leere Wohnung, wo seit Wochen renoviert wurde, nebenan schaute die Künstlerin aus der Tür. Es brennt doch nicht? Aber es brennt doch! Die Feuerwehr! Jetzt! Los!
Es gab noch die Idee mit den Wassereimern, aber daraus wurde aus Zeitmangel nichts. In weniger als fünf Minuten war blau blinkend die Feuerwehr da. Erst schickten sie einen zur Aufklärung hoch, dann rollten sie ihre Schläuche aus und setzten Sauerstoffflaschen und Masken auf. Unten auf der Straße sammelten sich bange Hausbewohner. Die Familie mit Kind aus der Wohnung darüber, darunter eine Wohngemeinschaft, o je, bitte nicht schon wieder ein Wasserschaden! Die Nachbarin, alle mit sorgenvollen Gesichtern in der Nacht. Immerhin: Flammen waren von unten nicht zu erkennen, was so gespenstisch orange zu flackern schien, war bloß die Gangbeleuchtung.
Natürlich denkt man darüber nach, was man retten würde. Den Dokumentenordner: Geburtsurkunde, Abiturzeugnis, Reisepass. Eine externe Festplatte mit dem letzten Backup. Das Notebook. Drei alte Tagebücher, Lieblingsplüschtiere. Eine Flasche Schnaps gegen den Schock. Was Warmes zum Anziehen. Blöderweise wäre man gar nicht mehr nach oben gekommen, hätte sich das Feuer wirklich ausgebreitet. Oder herunter? Wie schnell wäre das Treppenhaus wohl dicht gewesen? Andere Fluchtwege? Wirklich kein Feuerschein hinter den Fenstern im dritten Stock?
Jetzt beruhigt die Feuerwehr: Die Schleifmaschine habe Feuer gefangen und Sägespäne entzündet. Ein Schwelbrand. Am nächsten Morgen stellt sich dann heraus, dass nur das frisch verlegte Parkett angekokelt ist, am Ende, hieß es, habe ein Eimer Wasser zum Löschen genügt. Aber das ganze Haus war voller Rauch! Die Feuerwehrleute blieben noch mindestens eine Stunde vor Ort, rollten die Schläuche ein und gingen sorgsam jede Wohnung ab, ob nicht irgendwer doch zu viel Rauchgase eingeatmet hatte. Und im Treppenhaus stinkt es heute noch.
Was lernen wir daraus? Anscheinend ist es nicht so sehr das Feuer, sondern der Rauch, der die Menschen umbringt. Zweitens: Es gibt ihn eben doch, den Moment, wo man aus dem allgemeinen Vor-sich-Hindösen aufgescheucht wird, um das zu tun, was getan werden muss. Und dann ist da, drittens, die Feuerwehr. Plötzlich spielt es keine Rolle, ob sie, sagen wir: paritätisch besetzt sind oder ob es auf der Wache Gender-Toiletten gibt. Sondern dass die Polizei die Straße absperrt, ein Krankenwagen bereitsteht, als Reserve ein zweites TLF und im Notfall die Drehleiter. Sie verstehen ihren Job, keine Sorge. Und das ist in diesen schwierigen Zeiten unendlich angenehm.