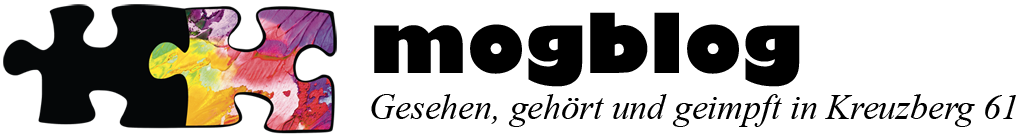Leider ist kein Beethoven der Lautsprecher in Sicht

Marie hat es gar nicht gefallen. Es dauerte eine Weile, bis sie damit herausrückte, sie murmelte etwas von "hartem Stoff" und als ich dann einwandte, der von ihr so heiß geliebte Free Jazz sei auch nicht besonders leicht verdaulich für das Gehör, stritten wir fast eine Stunde lang. Dabei ist sie eigentlich ein großer Fan der musikalischen Avantgarde und als wir vor einiger Zeit im BKA-Theater der "Unerhörten Musik" dort lauschten, schmolz sie geradezu dahin. Aber wenn es nur vom Band kommt oder eben aus der Konserve, hat es etwas Erkältendes.
"Laut! Sprecher! Musik!", hieß es vergangenen Freitag vielversprechend bei der Klangwerkstatt im Kunstquartier Bethanien. Unzählige Lautsprecher und Klangwandler waren im Raum aufgebaut. Sie sollten nicht nur technisches Übertragungsmedium sein, sondern "selbst bespielbares Instrument". Wer nun hoffte, das 2012 gegründete Berliner Lautsprecherorchester würde munter auf den Boxen herumtrommeln oder sonstwie analogen Krach erzeugen, sah sich enttäuscht. Es ging nur darum, durch "Anordnung und Reflektionen im Raum ungeheuer körperliche Klänge entstehen" zu lassen, dass das elektronisch erzeugte oder aufgezeichnete Geräusch also einen eigenen Ort zugewiesen bekommt - im Wechselspiel mit anderen Klängen an anderen Orten.
"Aber", hätte mein alter Musikprofessor argumentiert, "wenn Musik etwas mit Kunst zu tun haben will, dann genügt es nicht, nur eine Anzahl glitzernder Sonderbarkeiten beliebig aneinanderzureihen. Dann geht es um Sinn. Um Struktur. Um Zusammenhang!" An dieser Stelle hätte er angefangen, vom Kontrapunkt der Niederländischen Vokalpolyphonie zu schwärmen, vom Sonatenhauptsatz der Klassik und am Ende unweigerlich "Da-da-da-dam!" ausgerufen, immer wieder: "Da-da-da-dam!" Beethoven, Sie wissen schon. "Die Musik schläft in vielen Betten", hätte er gesagt. "Aber aus diesen vier Tönen eine halbe Sinfonie zu erschaffen, das ist wahre Kunst!"
Der Standpunkt hat etwas für sich. An diesem Abend erklangen viele Geräusche. Reißendes Papier, metallisches Kratzen, Rauschen, Quietschen, Pochen, außer Rand und Band geratene Maschinen (als ob im Raumschiff Enterprise der Warp-Antrieb ausfällt). Über "Fog Factory" von Hanna Hartman schrieb ein Rezensent bezeichnenderweise: "In ihrem Stück erzählt sie keine Geschichte. Sie möchte einfach, dass wir genau hinhören." Anais-Nour Benlachhab beeindruckte durch ihre Bühnenpräsenz im knallroten Body und am Ende wagte sich Malte Giesen beim Versuch, einen n-dimensionalen Körper "mit unendlich vielen Flächen" darzustellen, sogar an Arnold Schönbergs Gurrelieder. Allerdings "versechzehnfacht", wie er stolz bekannte.
Nun ja. Das war intensiv und sonderbar, gewiss, aber es zog vorüber. Haften blieb lediglich "blahblah" von Connor Shafran. Erinnert sich jemand an das große, eindrückliche Bla-Bla-Bla von Greta Thunberg vor dem Weltklimagipfel? Man hätte sich gewünscht, es wäre vielleicht eine Anspielung darauf, aber vermutlich komponiert niemand so schnell. Dass da einer abseits von allen konkreten politischen Inhalten begriffen hätte, was für ein handgreiflich-rhythmisches Potenzial in diesen absteigenden drei Silben steckt: "Bla-Bla-Bla! Da-da-da-dam! Bla-Bla-Bla!" Und einer hätte diese drei Silben von oben und unten, vorne und hinten auseinandergenommen, durch Himmel und Hölle gejagt, wie das in jenem berühmten Opus 111 mit einer schlichten Arietta geschieht, und sie nachher wieder liebevoll zusammengesetzt. Shafran gab sich redlich Mühe, ja. Aber ein Beethoven der Lautsprecher ist leider nicht in Sicht.