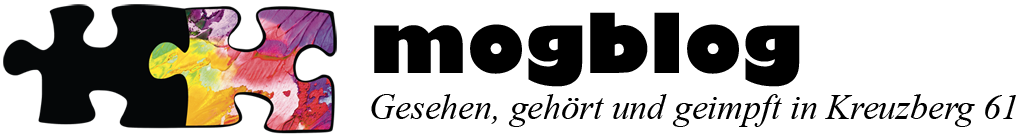Klaus Stark verschwendet seine wertvolle Freizeit beim Spiel mit bunten Bällen

Es fühlt sich an wie das Meer. Gut, da sind keine Wellen und es ist auch nicht blau, sondern grasgrün, aber der Tisch ist mindestens genau so groß. Am anderen Ufer sind vage die Umrisse eines roten Balls zu erkennen. Den muss man jetzt mit dem anderen, dem weißen Ball, treffen, und am Ende läuft es natürlich gerade so wie befürchtet: Der Stoß geht daneben, und man ist schon froh, die Weiße nicht verfehlt zu haben.
Das ist Snooker.
Snooker ist eigentlich mein Lieblingssport. Es fühlt sich wunderbar an, im warmen Sessel zu sitzen, eine Tüte Chips auf den Knien, und Ronnie O’Sullivan beim Potten zuzusehen. Am Anfang wirkt das Spiel ein wenig langweilig, und tatsächlich hat es fast ein Jahr gedauert, bis ich mir die Reihenfolge merken konnte, in der die bunten Bälle in ihre Löcher plumpsen müssen.
Aber langsam offenbaren sich die Feinheiten. Wie raffiniert ist das denn, den Gegner so zu blockieren, dass er keine Kugel mehr anspielen kann! Ich begriff, dass es vor allem auf die Ablage ankommt, auf den nächsten und den übernächsten Stoß! Schon ist man Fan, und so wie sich andere über Dortmund, Hertha oder den VfB ereifern, streitet man plötzlich über Ronnie » The Rocket« und John Higgins. Was für ein geniales Spiel!
Soweit die Theorie.
Dann steht der Autor plötzlich im Ballhaus in der Bergmannstraße am Snookertisch, der mit seinen 3,56 mal 1,78 Metern wirklich gewaltig ist, und versteht die Welt nicht mehr. Eben noch fühlte er sich als erwachsener Mann, der elegant rückwärts einparken kann, wahrscheinlich mit Leichtigkeit einen Bagger, vielleicht sogar ein Überschallflugzeug lenken könnte – aber die dämlichen Bälle weigern sich beharrlich, in den Löchern zu verschwinden, in die sie gehören.
Vielleicht fehlt es an der richtigen Haltung? Also Beine auseinander, Oberkörper nach unten, Kinn aufs Queue. »Du weißt schon, dass du Rücken hast?«, lässt sich der Rücken vernehmen. Und die Gleitsichtbrille, die auf die Nasenspitze rutscht, ist auch nicht wirklich amüsiert.
Ab und zu ein scheuer Seitenblick zu den KollegInnen. Glücklicherweise scheinen die vor allem mit ihrem eigenen Unglück beschäftigt und kriegen gar nicht mit, was man für ein Loser ist. Keine Frage: Das Queue in der rechten Hand fühlt sich ganz cool an. Es kommt auch gut, mit nachdenklicher Miene einmal rund um den Tisch zu spazieren, als ob man über komplizierte Stellungen brüten würde. Nur wäre es eben auch ganz schön, wenn das mit dem Einlochen besser klappen würde.
Nach viereinhalb Stunden haben alle fürs Erste genug. Im Laufe des Abends habe sie Fortschritte wahrgenommen, freut sich die Kollegin – »von abgrundtief schlecht zu ganz normal schlecht«. Ein Mit-Redakteur war beeindruckt »von der schieren Größe des Sportgeräts«. Ein zweiter ist frustriert. Er spiele lieber am Computer, sagt er: »Dort klappt es schon ziemlich gut.«
Auch der Autor zieht sich nach ein paar Bierchen an den heimischen Bildschirm zurück. Chips und Gummibärchen halt. Um sich dann das Maximum Break von Ronnie O’Sullivan von 1997 in fünf Minuten, 20 Sekunden reinzuziehen. Meine Fresse, ist das ein geniales Spiel!