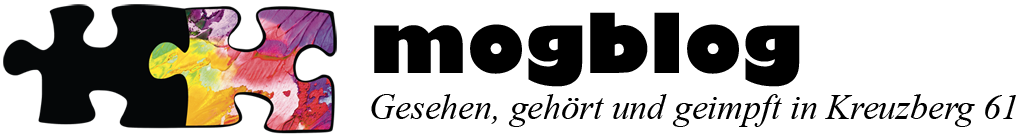Podiumsdiskussion zur wachsenden Drogenszene am Südstern

Am Marheinekeplatz und rund um den Südstern häufen sich die Beschwerden von Anwohnern. Sie beklagen Verwahrlosung und Vermüllung, vor allem aber eine sichtlich wachsende Drogenszene. Zum Marheinekeplatz fand im August ein Fachaustausch mit Stadtrat Knut Mildner-Spindler statt, dessen Hauptergebnis wohl darin bestand, dass weiter miteinander geredet wird. Zum Südstern stellte sich ein Präventionsteam der Polizei ebenfalls im August den Fragen von Bürgern. Viele Anwohner fühlen sich mittlerweile massiv beeinträchtigt. "Ich bin entsetzt, wie es sich entwickelt. Ich fühle mich nicht mehr sicher", sagte eine Frau aus der Fontanepromenade.
Am 27. Oktober luden Bürgergenossenschaft und Nachbarschaftshaus nun zu einer weiteren Diskussion. Diesmal sollte die Perspektive der Drogenkonsumenten im Mittelpunkt stehen. Sehr eindrücklich war das Statement von Francesca Guarascio von Fixpunkt e.V. Viele Junkies verstünden ihre Sucht als Krankheit, viele wohnen auf der Straße, berichtete sie. "Sie machen das nicht aus Spaß, sie sind gezwungen dazu. Wir kommen am Ende des Tages nach Hause und haben unseren Rückzugsraum. Sie haben das nicht." Während Drogenabhängige auf Unbeteiligte vielleicht aggressiv oder unzugänglich wirken, empfänden sie oft Furcht: "Fast alle haben Angst beim Kaufen von Drogen. Sie haben Angst, wenn sie sich im öffentlichen Raum einen Platz suchen müssen."
Lena Bolczek von Gangway macht seit drei Jahren "klassische Straßensozialarbeit" und versucht, Obdachlose und Drogenabhängige in bestehende Hilfssysteme zu vermitteln. Südstern, Marheinekeplatz und vor allem der Görli gehören zur üblichen Route. Oft dauere es sehr lange, überhaupt Vertrauen aufzubauen, berichtete sie. Von einer Räumung bestimmter Plätze hält sie deshalb überhaupt nichts: "Es kann sein, dass wir dann den Kontakt komplett verlieren."
Romy Kistmacher koordiniert beim Bezirk die Suchthilfe und geriet als einzige Vertreterin einer Behörde auf dem Podium gewissermaßen in Bringschuld. Würden mehr Konsumräume nicht helfen? "Es gibt den politischen Willen", sagte sie, verwies aber auf "Schwierigkeiten, das umzusetzen". Niemand wolle eine Fixerstube in seiner Nähe, die Privatisierung der Stadt ließe Rückzugsräume schwinden und die Gewerbemieten steigen. Außerdem werde die Suchthilfe bei illegalen Drogen schließlich berlinweit von der Senatsverwaltung für Gesundheit und nicht vom Bezirk organisiert.
Wenn ein richtiger Konsumraum praktisch unerschwinglich sei, täte es zumindest als Notlösung nicht ein Container auf dem Kirchvorplatz?, wollte eine Anwohnerin wissen. Keine gute Idee, fand Kistmacher. "Man braucht fließendes Wasser, Strom, eine Notfallversorgung und Personal." Außerdem sei so ein Container "jetzt nicht wirklich eine würdige Einrichtung". Am Ende blieben viele Fragen offen. Veit Hannemann von der Bürgergenossenschaft sprach das Schlusswort. Jeder einzelne sei aufgerufen, "sich um die Leute zu kümmern", sagte er. Aber es könne auch nicht darum gehen, dass Ehrenamtliche im Rahmen ihres Engagements für die Nachbarschaft Probleme lösen, die "von der Politik verschlafen worden sind".