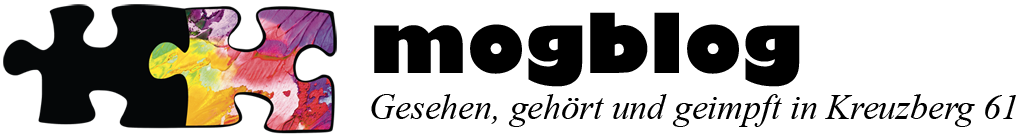"Little Ethiopia" in der Gneisenaustraße serviert Köstliches

Es gibt auf der ganzen Welt nichts Köstlicheres als äthiopisches Essen. Die Bibel berichtet, dass es Gott Wachteln und Manna regnen ließ, um sein Volk auf dem langen Marsch durch die Wüste zu nähren. Es muss sich um einen Übersetzungfehler handeln. In Wirklichkeit waren es Siga Wot, scharfes Rindfleisch, und Injera, das legendäre, säuerlich schmeckende Fladenbrot, welches der Herr gnädig vom Himmel warf, um die Israeliten vor dem Hunger zu retten. Und wenn den Muslim im Paradies tatsächlich 72 großäugige Huris erwarten sollten, dann servieren auch sie bestimmt äthiopische Speisen.
Der normale Mitteleuropäer bewegt sich kulinarisch üblicherweise zwischen Kartoffeln, Nudeln und Reis. Brot wird aus Mehl gebacken, was genauso für das mittelmeerische Pide und arabische Fladen gilt, und wer besonders mutig ist, wagt sich an Couscous, Bulgur, Süßkartoffeln oder Kochbananen heran. Injera - die Grundlage fast aller äthiopischen oder eritreischen Gerichte - ist etwas anderes. Ein weicher, leicht zwischen den Fingern zu zerteilender Sauerteig, der einige Tage gären muss und aus dem heimischen Teffmehl bereitet wird. Er schmeichelt den Geschmacksnerven im Mund und er schmeichelt ihnen so, dass man den Geschmack tagelang nicht mehr vergisst.
Wer es romantisch haben will, mag sich nun braunhäutige Frauen vorstellen, welche das leckere Fladenbrot mit den auffälligen Poren auf heißen Steinen backen oder über einem traditionellen Feuer aus Kamelmist. Tatsächlich gilt das glutenfreie, mineralstoffreiche Teffmehl den einen als Super-Getreide, das äthiopische LäuferInnen zu Weltrekorden treibt. Andere bringen die Zwerghirse wegen der überaus bescheidenen Erträge mit den in Äthiopien immer wieder auftretenden Hungersnöten in Verbindung. Auf dem Teller dient es als Grundlage für Grünkohl, gelbe Erbsen, rote Linsen, Weißkohl mit Karotten, Schichtkäse, scharfes Rindfleisch und Eisbergsalat mit Tomaten.
Gegessen wird natürlich mit den Fingern. Dazu reißt man ein Stück Injera ab und greift sich damit Gemüse oder Fleisch. Kurban Said schildert im Roman "Ali und Nino" die im Orient verbreitete Kunst, drei Finger in eine "fette, dampfende Reisspeise" zu stecken, ein Häuflein davon zu einer Kugel zusammenzuquetschen und diese dann zum Mund zu führen, "ohne auch nur ein Körnchen Reis fallen zu lassen". Hierzulande gilt hingegen der Gebrauch von Messer und Gabel als zivilisiert. Aber wer einmal einen Teller Injera mit der bloßen rechten Hand vertilgt hat, spürt, wie die Distanz zwischen Mensch und Essen auf rätselhafte Weise schwindet und dass es so intensiver schmeckt.
Jetzt kann man darüber klagen, dass sich äthiopische oder eritreische Restaurants zunehmend an den europäischen Geschmack anpassen und den Teig nur kurz gären lassen oder Vollkornmehl benutzen oder auf vegetarische Gerichte setzen, weil das eben Mode ist. Dabei besteht das Geheimnis dieses wunderbaren Essens gerade aus der Kombination des säuerlichen, die Geschmacksknopsen aufschließenden Fladens mit der megascharfen Fleischsauce. Das Zauberwort lautet dabei Berbere - eine Mischung aus Kreuzkümmel, Kardamom, Koriander, Knoblauch, Kurkuma, Ingwer, Paprika, schwarzem Pfeffer, Bockshornklee, Zimt, Piment und Chili.
Das wollen wir nicht weiter vertiefen und stattdessen in höchsten Tönen das "Little Ethiopia" in der Gneisenaustraße 63 loben. Ein kleines Restaurant, das man leicht übersehen kann, mit nur wenigen Tischen, einer eher kurzen Speisekarte, liebevoll geführt von Ethiopia Mandefro und Theodros Kassa. Sehr authentisch, ein Geheimtipp, wo das heiße Essen aus den Töpfen direkt auf die mit hübschen Bastdekorationen geschmückten Teller kommt, zum Glück noch unentdeckt von den großen Touristenströmen. Einziger Nachteil: So riesig auch anfangs der Hunger ist, so lecker es schmeckt, so heftig dann die Berberesauce im Rachen brennt - irgendwann ist leider doch alles aufgegessen und der Gast ist satt.